On History
Im ersten von drei Auszügen aus The Work of the Dead: A Cultural History of Mortal Remains erforscht Thomas Laqueur die Nekrobotanik der Eibe, „dem Baum der Toten“, der auf Friedhöfen in Großbritannien, Frankreich und Spanien zu finden ist.

William Turner, Pope’s Villa in Twickenham, 1808.
Ein Friedhof grenzte an eine Kirche; beide enthielten die Gebeine der Toten. Die drei – das Gebäude, der Boden, die Toten – waren durch eine gemeinsame Geschichte verbunden, die sie zu einem Teil dessen machte, was im 18. Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit war; wenn es jemals eine organische Landschaft gab, dann war es der Kirchhof.
Die langlebige europäische Eibe – Taxus baccata, der Baum der Toten, der Baum der giftigen Samen – zeugt von der Antike des Kirchhofs und beschattet seine „schroffen Ulmen“ und die Hügel und Furchen seiner Gräber: Die Eibe der Legende ist alt und erhebt Anspruch auf eine uralte Präsenz. Wir sprechen hier von zwei oder drei Dutzend exemplarischen Riesen, manche mit einem Umfang von zehn Metern, die zwischen 1.300 und 3.000 Jahren stehen, aber auch von vielen bescheideneren und historisch belegten Bäumen, die seit Jahrhunderten leben und an die man sich erinnert. Mindestens 250 Eiben sind heute so alt oder älter als die Kirchhöfe, auf denen sie stehen. Einige waren schon da, als die ersten sächsischen und sogar die ersten britischen christlichen Flechtkirchen gebaut wurden; eine Urkunde aus dem siebten Jahrhundert aus Peronne in der Picardie spricht von der Erhaltung der Eibe am Standort einer neuen Kirche.
Wie alt ein bestimmter Baum sein könnte, war und ist umstritten. Schätzungen hingen davon ab, dass man zwei oder mehr Messungen des Umfangs über einen langen Zeitraum hatte und dann eine Formel anwendete, die die Wachstumsrate in die Vergangenheit projizierte. Diese Formeln wurden wiederum von anderen seriellen Messungen abgeleitet – so viele Fuß in so vielen Jahren – und durch Umfangsmessungen von Bäumen ergänzt, deren Alter aus schriftlichen Belegen bekannt war. In der Tat ist eine genaue Datierung wahrscheinlich unmöglich, und jeder hat es zugegeben. Es gibt zu viele Variablen, die die Wachstumsrate eines Baumes bestimmen, um ein verlässliches Verhältnis für Änderungen des Umfangs pro Jahrzehnt abzuleiten. Aber niemand stellt in Frage, dass Eiben tausende von Jahren leben: „Die meisten Bäume sehen älter aus als sie sind“, sagt der Dendrologe Alan Mitchell, „mit Ausnahme der Eiben, die noch älter sind, als sie aussehen.“ Sie sind seit jeher ein fester Bestandteil des Kirchhofs. Sie sind Bäume der tiefen Vergangenheit; ihre Geschichte bürgt für das Alter der kirchlichen Landschaft.
Der Antiquar Daniel Rock aus dem neunzehnten Jahrhundert spekuliert, dass die Eibe auf dem Kirchhof von Aldworth, Berkshire, möglicherweise von den Sachsen gepflanzt wurde. John Evelyn, der Tagebuchschreiber und Autor über Forstwirtschaft aus dem 17. Jahrhundert, vermaß diesen Baum; Augustin Pyramus de Candolle (1778-1841), der berühmte Schweizer Botaniker, vermaß ihn ein Jahrhundert später erneut und nutzte die Differenz, um das Verhältnis von Alter und Umfang zu berechnen; Rock selbst vermaß ihn 1841 und stellte fest, dass er seit seiner Aufzeichnung in Beauties of England (1760) um einen Meter im Umfang gewachsen war. Dutzende anderer alter Eiben auf dem Friedhof haben ihre eigene, gut dokumentierte Geschichte. Dies sind die Berühmtheiten der Spezies, die dem Altertum des Kirchhofs und seiner Toten eine Stimme geben. Tausende von gewöhnlichen Eiben haben Anteil an der Aura der Art.
Es ist „beneath the yew-tree’s shade“, der „heaves the turf in many a mouldering heap“, wie es in Thomas Grays „Elegy Written in a Country Churchyard“ heißt. Taxus baccata wirft seinen Schatten fast immer dort, wo die Toten liegen, an der Süd- und Westseite der Kirche. Wie die Leichen, über die er wacht, ist er selten auf der Nordseite zu finden, und dann auch nur in Ausnahmefällen. Einige glauben, so Robert Turner, der seltsame, gelehrte und wunderbare Übersetzer vieler mystischer und medizinisch-chemischer Texte aus dem 17. Jahrhundert, dass dies daran liegt, dass die Zweige der Eiben die „groben und öligen Dämpfe, die von der untergehenden Sonne aus den Gräbern ausgeatmet werden, anziehen und aufsaugen“. Sie könnten auch das Erscheinen von Geistern oder Erscheinungen verhindern. Nicht absorbierte Gase erzeugten die ignes fatui, das „törichte Feuer“, wie das, das Reisende über Mooren und Sümpfen sahen, und diese konnten im Zusammenhang mit Kirchhöfen mit wandelnden Leichen verwechselt werden. Abergläubische Mönche, so fährt er fort, glaubten, dass die Eibe den Teufel vertreiben könne. Ihre Wurzeln seien giftig, weil sie „rennen und den Toten die Nahrung entziehen“, deren Fleisch „das übelste Gift ist, das es gibt.“
Aber Turners phantasievolle Behauptungen über die ökologische Anpassung der Eibe sind ein wenig post hoc. Die grundlegendere Frage ist, warum die Eibe überhaupt so eng mit den Toten in Verbindung gebracht wurde. Und wie alle Fragen, die mythische Anfänge suchen, ist sie unbeantwortbar. Oder vielmehr hat sie zu viele Antworten. Die Eibe war Hekate heilig, der griechischen Göttin, die mit Hexerei, Tod und Nekromantie in Verbindung gebracht wurde. Der Dichter Statius aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, der von den Volkskundlern des 19. Jahrhunderts oft zitiert wird, sagt, dass der Orakelheld Amphiaraus, der von Zeus‘ Blitz getroffen wurde, so schnell aus dem Leben gerissen wurde, dass „die Furie ihn noch nicht mit einem Eibenzweig getroffen und gereinigt hatte, noch hatte Proserpine ihn am düsteren Türpfosten als zur Gesellschaft der Toten zugelassen gekennzeichnet“. Die Druiden assoziierten den Baum mit Todesritualen. Tatsächlich war es die lange heidnische Geschichte der Bäume, die die Führer der katholischen Gegenreformation dazu veranlasste, ihre Anpflanzung gänzlich zu verbieten, und einige motivierte – ein Bischof von Rennes im frühen siebzehnten Jahrhundert war ein berühmter Fall – angesichts des Widerstands der Bevölkerung erfolglos zu versuchen, insbesondere die Eibe zu verbieten. Der englische Klerus nach der Reformation unternahm keine derartigen Anstrengungen. Die Dichter des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts erzählen uns, dass das Eibenblatt Gräber bedeckte und Leichen salbte. Der Narr Feste in Twelfth Night singt von seinem „Leichentuch aus Weiß, ganz mit Eibe beklebt“. All dies war in den antiken Geschichten ein Gemeinplatz. Genauso wie die Assoziation der Eibe mit der Geschichte der Passion Christi – mit Aschermittwoch und Palmsonntag. Nur wenige Bäume waren so tief in der Zeit der Toten verwurzelt.

John Burgess, Yews in a Country Churchyard.
Im frühen achtzehnten Jahrhundert tauchte in Europa ein Rivale auf, der nicht durch eine lange Geschichte belastet war: die Trauerweide. Sie gelangte aus China über Syrien nach England, weil ein Kaufmann aus Aleppo namens Thomas Vernon ein Exemplar an Peter Collinson, den wichtigsten Mittelsmann im weltweiten Pflanzentausch, weitergab. Dieser wiederum gab das Exemplar irgendwann in den frühen 1720er Jahren an Alexander Pope für seine Gärten in Twickenham. Zu dieser Geschichte gibt es Varianten: Vernon war Popes Vermieter und könnte sie ihm daher direkt geschenkt haben; sie könnte auch schon etwas früher in England aufgetaucht sein. Aber die Trauerweide war im achtzehnten Jahrhundert unbestreitbar neu und fremd, und frühe Exemplare wie das von Pope genossen die Aufmerksamkeit, die dem neuen Baum in der Stadt zuteil wurde. Salix Babylonica nannte Linnaeus sie, weil er sie fälschlicherweise für den Baum der Klage in Psalm 137 hielt: „An den Strömen Babylons, dort setzten wir uns nieder, ja, wir weinten, wenn wir an Zion dachten. / Wir hängten unsere Harfen an die Weiden in ihrer Mitte.“ Man kann ihm seinen Fehler verzeihen. Die Taxonomie der Weiden ist, wie uns der führende Experte sagt, „verwirrend“. Die echte Salix babylonica ist in kalten Klimazonen zerbrechlich und könnte inzwischen ausgestorben sein, so dass unsere moderne Trauerweide eine ihrer Züchtungen ist, Salix × sepulcralis, die durch Kreuzung mit der europäischen weißen Weide, Salix alba, entstanden ist.
Die Weide weint und trauert vielleicht wegen ihrer hängenden Blätter oder weil sie fälschlicherweise der Baum der Klagen der alten Hebräer genannt wurde. Aber wie auch immer sie zu ihrem Namen kam und was auch immer ihre genaue Genealogie ist, sie ist das gärtnerische Gegenteil von Taxus baccata: flachwurzelnd, kurzlebig und ohne historisches Gepäck, bis Alexander Pope sie berühmt machte. Seine Villa wurde 1808, kein Jahrhundert nach Ankunft der Trauerweide, abgerissen, weil der neue Besitzer der Touristen überdrüssig war. Der Maler J. M. W. Turner malte die Ruinen und sah den berühmten Baum, jetzt ein sterbender Stamm, und schrieb darüber:
Pope’s willow bending to the earth forgot
Save one weak scion by my fostering care
Nursed into life which fell on bracken spare
On the lone Bank to mark the spot with pride.
Zehntausende von Ablegern wurden von Twickenham aus vor dem traurigen Ende von Papes Baum ausgesandt.
Bilder von Salix babylonica oder vielleicht Salix × sepulcralis, der Trauerweide, schmückten die neuen kommerziellen Bestattungsanzeigen und Trauermemorabilien des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts; sie beschattete das Grab von Rousseau in Ermenonville. Schwermut, dachte John Claudius Loudon, der gelehrteste Gartenbauer des neunzehnten Jahrhunderts, sei der natürliche Ausdruck der Eibe, Melancholie der der Trauerweide. Ihre herabhängenden Äste machten sie zu einem natürlichen Zeichen der Trauer. Innerhalb eines Jahrhunderts wurde der Fremde ohne Geschichte zum ikonischen Baum der parkähnlichen Friedhöfe des neunzehnten Jahrhunderts. Es war der Baum nicht der unsterblichen Toten, sondern der Trauer, ein Baum nicht für die Ewigkeit, sondern für die drei Generationen, für die die Toten hoffen können, erinnert zu werden.
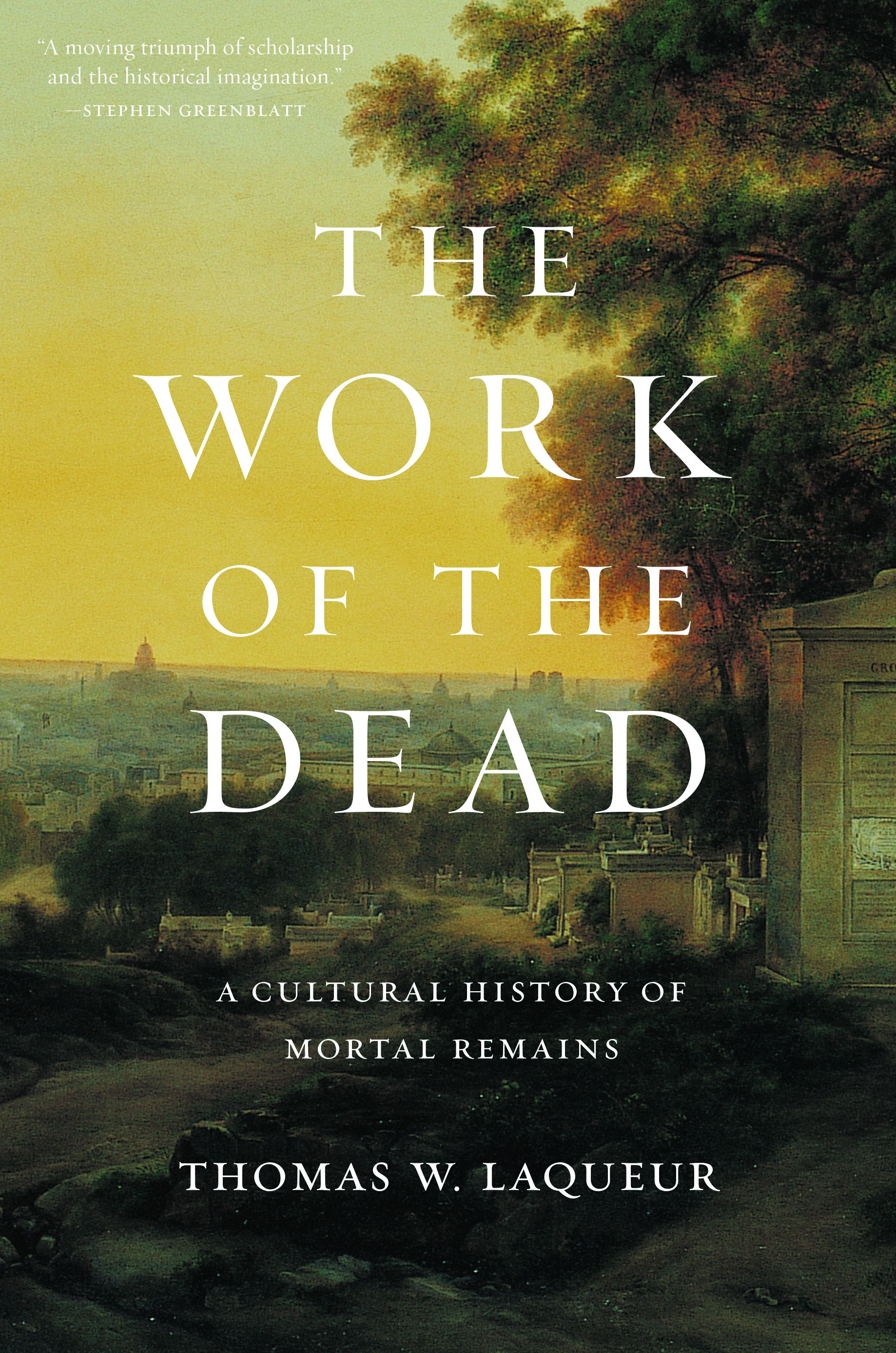 Thomas W. Laqueur ist der Helen Fawcett Professor of History an der University of California, Berkeley. Zu seinen Büchern gehören Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud und Solitary Sex: Eine Kulturgeschichte der Masturbation. Er schreibt regelmäßig für die London Review of Books.
Thomas W. Laqueur ist der Helen Fawcett Professor of History an der University of California, Berkeley. Zu seinen Büchern gehören Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud und Solitary Sex: Eine Kulturgeschichte der Masturbation. Er schreibt regelmäßig für die London Review of Books.